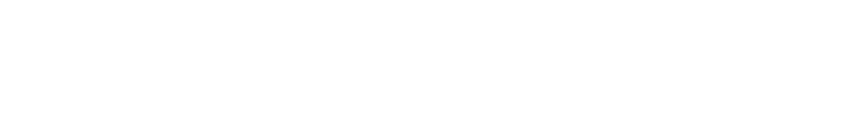Interview mit Regisseur Christian Petzold
Welche Verbindung haben Sie zu ‚Transit‘, dem Roman von Anna Seghers?
Ich habe ‚Transit‘ vor vielen Jahren durch Harun Farocki kennengelernt, für den das eines der wichtigsten Bücher war. Harun ist 1944 geboren, im Sudetenland, auf der Flucht, und ich glaube, dass er immer versucht hat, eine Referenz zu den 20er Jahren wiederzufinden, zu Autoren wie Franz Jung, Georg Glaser oder Anna Seghers. Was vor dem Faschismus lag, das ist ja im Grunde verlorene Heimat. Und ‚Transit‘ ist ein Buch, das im Übergang geschrieben ist. Wir haben diesen Roman im Lauf der Jahre immer wieder gelesen, weil das ein Buch war, wo wir uns getroffen haben: Dieses Im-TransitRaum-Sein und gleichzeitig daraus eine Figur zu gewinnen, die sich in diesem Raum eine Erzählung baut, die ohne Heimat auskommt, das ist das Tolle an dem Buch. Die Heimat gibt es bei ‚Transit‘ nicht. Die Heimat ist im Grunde die Heimatlosigkeit.
Wie ist die Idee entstanden, die ‚Transit‘ -Erzählung von 1940 im heutigen Marseille zu drehen?
‚Phoenix‘ hatte ich ja noch mit Harun Farocki zusammen gemacht, als historischen Film, in dem wir uns in dieser Zeit aufhalten und diese Zeit, die Situation und die Gefühle rekonstruieren. Auch für ‚Transit‘ hatten Harun und ich ein erstes Treatment geschrieben, wo alles als historischer Film gedacht war, Marseille 1940. Das habe ich mir nach dem Tod von Harun wieder vorgenommen, und ich hatte das Gefühl, das Drehbuch schreibt sich wie von selbst, aber gleichzeitig hatte ich überhaupt keine Leidenschaft dafür. Dann ist mir klar geworden, dass ich überhaupt keine Lust auf einen historischen Film hatte. Ich wollte nicht Zeiten rekonstruieren. Wir haben überall auf der Welt Flüchtlinge, wir leben in einem Europa der Renationalisierungen, da will ich nicht mit einem historischen Film zurück in den sicheren Bereich gehen.
Ich habe dann zwei Filme fürs Fernsehen gemacht, die heute spielen, in einer Welt, die ich kenne. Dass ich danach wieder zu ‚Transit‘ zurückgekehrt bin, hängt mit zwei Sachen zusammen. Ich hatte mit einem Architekten geredet, der mir erklärte, das Wunderbare an der DDR-Stadtarchitektur sei, dass die alten Sachen nicht abgerissen wurden, sondern das Neue daneben gebaut wurde. Die Geschichte liegt nicht verborgenen Schichten untereinander, sondern nebeneinander, man kann sie lesen. Und es gab die Debatte in München über die Stolpersteine, die an die deportierten jüdischen Bewohner erinnern und die für mich eines der ganz großen Kunstwerke heute sind: Man geht durch das Heutige und sieht das Vergangene, das sind wie Gespenstersteine.
So dachte ich plötzlich nochmal über ‚Transit‘ nach. Ein Transitraum ist ein Übergangsraum, so wie die Boarding Zone im Flughafen, man gibt alles ab, aber man ist noch nicht irgendwo angekommen. Bei Anna Seghers ist der Transitraum beschrieben als der zwischen Europa und Mexiko, und gleichzeitig kann man den Transitraum historisch sehen, wie eben bei den Stolpersteinen oder der Architektur, als Transitraum zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart.
War es schwierig beim Schreiben, diese beiden Zeiten, 1940 und das heutige Marseille, aufeinander prallen zu lassen?
Ich hatte mir, bevor ich mit dem Drehbuch begann, einfach versucht vorzustellen, wie das aussehen könnte, wenn ich die Bewegungen der Flüchtlinge im heutigen Marseille zeige, ohne das zu problematisieren. Und ich war überhaupt nicht irritiert. Ich konnte mir vorstellen, dass jemand mit einem Anzug und einem Seesack am Hafen von Marseille langläuft, sich einmietet in ein Hotel und sagt: „In drei Tagen kommen die Faschisten, ich muss hier raus.“ Das hat mich überhaupt nicht irritiert. Und das irritierte mich, dass es mich nicht irritierte. Das hieß für mich, dass die Fluchtbewegungen, die Ängste, die Traumata, die Geschichten der Menschen, die vor über 70 Jahren in Marseille festhingen, sofort verständlich sind. Die müssen überhaupt nicht erklärt werden. Das fand ich überraschend.
War es klar, dass Sie ‚Transit‘ unbedingt in Marseille drehen wollten?
Ich finde, es ist für die Schauspieler und für alle Beteiligten eine Verpflichtung, sich mit der Stadt in Verbindung zu setzen, die Teil der Erzählung ist. Die Welt gehört uns nicht, sondern wir müssen uns in ein Verhältnis zu ihr setzen. Und diese Welt dort in Marseille ist komplex. Es ist eine Hafenstadt, die Millionen von Touristen aufnimmt, aber man sieht die nicht. Die Stadt ist in ihrer Komplexität so stark, dass sie die Touristen nicht braucht. Wir wohnten in einem Hotel im Panier-Viertel und haben auch einige Szenen dort gedreht. Die Deutschen haben im Krieg das halbe Viertel gesprengt, weil das ein Widerstandsnest war. In den 50er Jahren wurde neu gebaut, aber man sieht überall noch Reste des alten Le Panier. Und als Teil der Proben sind wir oft dahin gegangen, wo wir drehen wollten, wir schauten uns die Stadt an, bevor sie Drehort wurde, bevor wir sie mit unseren Scheinwerfern illuminieren. Wenn man an so einem Ort ist, wo das Heute und das Gestern so sichtbar sind, ist das einfach reich für einen Film, in dem sich die Zeiten überlagern. Was großen Spaß gemacht hat, war das Drehen mitten im Alltag. Scorsese hat einmal gesagt, er hasst das, Straßen abzusperren und die Welt mit einer Komparsenchoreografie nachzubauen. Wir haben immer nur drei Komparsen in der Nähe der Kamera gehabt, ansonsten haben wir einfach gedreht, was da war.
Welche Überlegungen hatten Sie zum Ko-stümbild und dem Szenenbild?
Transiträume sind immer Balanceakte. Wir mussten immer die Balance halten zwischen etwas, das man heute noch findet, und etwas, das die Zeichen nicht zu modern macht. Wir wollten keine Blase von alten Gespenstern, die durch das heutige Marseille laufen, sondern diese Gespenster sind von heute. Katharina Ost, die Kostümbildnerin, hatte gleich gesagt: Wir machen nicht Retro, aber auch nicht ganz modern, sondern wir bleiben in dem Bereich von klassischer Linie, klassische Hemden, klassische Anzüge. Nur die Art und Weise, wie die Kleider abgetragen sind, erzählt von den sozialen Herkünften. Beim Szenenbild war das ähnlich. In den kleinen Hotels zum Beispiel, die wir uns in Marseille angesehen haben, brauchten wir fast nichts zu ändern. Wir haben manchmal die Wände gestrichen, aus ästhetischen Überlegungen, aber das war schon alles. Die Wohnung von Driss ist fast komplett so, wie wir sie vorgefunden haben. Wir sind da rein und dachten: So ist es, hier können wir das drehen. Manches ging dann auch nicht. Das originale Mont Ventoux z.B. gibt es in Marseille noch, aber da ist jetzt McDonalds drin, das ist vorbei. Aber gleich daneben gibt es diese Lokale, die im Grunde immer so aussehen wie früher, karierte Tischdecken, Pizza, Rosé ... Da gab es überhaupt kein Befremden.
Das, was vielleicht einmal ein Zuhause für Georg war, seine Vorgeschichte, wird im Film nur angedeutet.
Anna Seghers hat die Geschichte wie eine moderne Ich-Erzählung geschrieben. Ein Flüchtling erzählt einem anderen eine Geschichte. Er hat Angst zu langweilen, weil er umgeben ist von solchen Flüchtlingsgeschichten. Und im Erzählen – gerade wenn man traumatisiert ist, wenn man etwas verloren hat, seine Sprache, seine Heimat – tauchen unvermittelt Bruchstücke aus der Erinnerung auf. Diese Erinnerungsproduktion gibt es im Roman, die Lieder der Mutter, Gerüche, Bilder aus der Kindheit, das Licht. Das kommt aus tieferen Schichten, als ob die Erinnerung weggesperrt gewesen wäre, weil man mit Heimweh auf der Flucht untergehen würde. Diese Bruchstücke sind bei Anna Seghers sprachlich unglaublich schön. Wenn sich der Erzähler erinnert, kommt ein ganz anderer Rhythmus in den Text. Und wenn der Georg im Film das Manuskript des Schriftstellers liest oder wenn er das Abendlied von Hanns Dieter Hüsch singt, dann erinnert er sich plötzlich daran, wie schön die Sprache gewesen ist, wie schön die Musik gewesen ist, bevor die Sprache der Nazis, die Filme, die Propaganda, die Besetzung des Mythos im Grunde genommen die Kultur zerstört hat.
Warum haben Sie sich gegen eine Ich-Erzählung wie im Roman entschieden?
Ich habe mit Ich-Erzählungen im Kino große Schwierigkeiten. Ich glaube das nicht. In einem Roman wendet sich ein Erzähler in seiner Einsamkeit an einen Leser, der genauso alleine ist. Ein Ich-Erzähler im Kino wendet sich aber nicht an ein einsames Subjekt, sondern an einen Raum, einen Zuschauerraum. Wenn einer im Kino „Ich“ sagt, ist das keine Haltung, sondern da quatscht uns einer voll. Mein Vorbild war ein bisschen die Erzählhaltung bei ‚Barry Lyndon‘ von Kubrick. Da ist ein Erzähler, der seine Figur Barry Lyndon betrachtet und sie in ihren Schwächen liebt. Wenn unsere Hauptfigur betrachtet wird, nehmen wir eine Haltung zu ihr ein. Ich habe mich gefragt, wer der Erzähler in ‚Transit‘ sein könnte. Georg hat keine Freunde, er zieht umher. Es musste jemand sein, dem Georg die Geschichte erzählt hat und der uns jetzt diese Geschichte weitererzählt, während wir diese Geschichte sehen. Deshalb ist es wichtig, dass der Barkeeper, den wir spät als Erzähler identifizieren, am Ende das Manuskript des Schriftstellers überreicht bekommt.
Hatten Sie überlegt, ganz ohne Voice Over auszukommen?
Ich wollte den Film so machen, dass er ohne Voice Over funktionieren würde. Was mich interessiert hat, waren die Passagen. Die Begriffe „Transit“ und „Passage“ liegen so eng beieinander. Es gibt einen berühmten Text von Béla Balázs, der eine Szene mit Lillian Gish beschreibt: Sie erfährt, dass ihr Kind gestorben ist, dann dreht sie sich ab und geht, und die Kamera bewegt sich mit ihr mit. Das nennt Balázs eine Passage: Der Raum, den wir selber auffüllen. Wir sehen die Figur, die für sich bleibt, und wir bleiben für uns, und trotzdem gibt es eine Verbindung. So habe ich die Voice-Over-Stellen gesehen, als Passagen, wie eine Passagenmusik.
Sie haben im Zusammenhang von ‚Transit‘ vom Moment der „Geschichtsstille“ gesprochen.
Ich habe in der Vorbereitung Georg K. Glaser nochmal gelesen, ‚Geheimnis und Gewalt‘, auch eines der Lieblingsbücher von Harun und mir, das für die Arbeit am Drehbuch dann sehr wichtig war. Der Georg Glaser ist auch aus Nazideutschland geflohen, aus dem Lager, er war Kommunist wie Anna Seghers, aber er war kein Intellektueller. Als er „Geheimnis und Gewalt“ geschrieben hat, retrospektiv, hatte er bereits seine zweite Heimat verloren, die Kommunistische Partei. Bei ihm taucht der Begriff „Geschichtsstille“ auf, der mich so beeindruckt hat. Aus dieser Geschichtsstille heraus kann er wieder irgendwo ankommen, er wird Franzose und baut sich ein neues Leben. Während Anna Seghers einsam blieb: Wenn man ihre mexikanischen Bücher liest, merkt man, dass sie versucht, sich reinzuschreiben, aber dass sie nicht dazu gehört.
Im Transit-Roman ist das Manuskript, das der Schriftsteller Weidel hinterlässt, im Grunde genommen der Text, den Anna Seghers schreibt und den man auch in einem Hotelzimmer hätte finden können. Und die Produktion dieses Textes, der gleichzeitig der Text des Erzählers ist, ist der Versuch, die Verzweiflung zu überwinden und aus der Geschichtsstille heraus einen neuen Anfang zu finden. Das ist der Moment, wenn der Georg das Manuskript liest und sagt: „In diesem Moment verstand ich die ganze Geschichte, ich verstand mich, ich verstand die Schwächen aller dieser Menschen, es wurde eine Erzählung, in der man sich nicht mehr lustig machen wollte über die Unberatenen, sondern in der ihr Unberatensein und ihre Hilflosigkeit menschlich wurden.“
Hat Georg die Flucht so verinnerlicht, dass es ihm schwerfällt, ein Ziel über das Sich-Durchschlagen hinaus zu haben?
Das Schöne an einem Entwicklungsroman wie ‚Transit‘ ist, dass man mitbekommt, wie jemand ein Mensch wird, der Sinne hat, der Erinnerungen hat, der Begehren und Wünsche hat. Der Georg ist erst einmal leer, ein Spielball der Geschichte, er läuft herum, er sitzt in Bistros, er hat keine Vergangenheit und keine Zukunft, er lebt nur in der Gegenwart. Er schlägt sich gut durch, weil er glaubt, dass er nichts zu verlieren hat und auch nichts verloren hat. Er ist clever, fast wie ein Krimineller, er kann die Zeichen lesen, er weiß sich zu verstellen. Erst mit der Lektüre des Manuskriptes auf der Flucht, während sein Freund neben ihm stirbt, beginnt er plötzlich, so etwas wie ein tragischer Held zu werden. Das ist seine Entwicklung. Er verliebt sich, er hat ein Ziel, obwohl alles auf Lüge aufbaut, mit der Identität eines anderen. Aber er bekommt im Laufe der Geschichte eine Identität als einer, der wünscht, der begehrt, der am Schluss sogar Opfer bringt.
Ist Georgs Beziehung zu Driss, dem Jungen, eine Möglichkeit für ihn, zu bleiben?
Das ist sehr schön, wie die Schauspieler das spielen, wenn der Georg dem Driss das Kinderlied vorsingt. Durch die Anwesenheit des Kindes bekommt er eine Vergangenheit, eine Erinnerung, er wird selbst zum Kind in diesem Moment. Dann kommt die Mutter dazu, die ihn am Anfang verachtet, weil sie sofort erkannt hat, dass er eine verantwortungslose Pfeife ist. Aber wenn er anfängt zu singen, verändert sich das. Da wird er angenommen. Es bietet sich für ihn die Möglichkeit, mit einer Familie wegzugehen und sich zu verantworten. Und das tut er nicht. Nach Jahren auf der Flucht ist der Egoismus stärker als die Solidarität. Aber er empfindet Schuld darüber, und dieses Schuldgefühl ist etwas Neues für ihn.
Das Manuskript des Schriftstellers ist unvollendet. Der Schluss des Romans legt nahe, dass der Erzähler in die Berge geht.
Ja, das ist möglich, dass er das macht. Aber er sitzt auch bei Anna Seghers noch im Mont Ventoux, obwohl er da schon längst nicht mehr hätte sitzen dürfen – das ist ja der Anfang des Romans. Das ist ein schönes Bild, wenn er sagt: „Marie kommt aus dem Schattenreich.“ Und jedes Mal, wenn die Tür aufgeht und ein Schatten über die Wand geht, schaut er auf. Er sieht immer die Schatten, die das Lokal betreten, und der nächste Schatten könnte Marie sein. Das ist vielleicht der schönste Moment, dass einer, wenn er schon in der Welt der Erzählung, der Fiktion ist, sagt: „Wenn unsere Heimatlosigkeit zu einer schönen und leidenschaftlichen Erzählung wird, aber nicht beendet ist, weil sie modern ist, dann kann ich auch hier in diesem Restaurant warten, bis Marie aus dem Reich der Toten zurückkommt.“
Würden Sie ‚Transit‘ als Liebesfilm beschreiben?
Ja. Ich glaube, man kann eine Flucht nur als eine Liebesgeschichte erzählen. Die Liebe braucht Zeit, aber die Liebe hat auch etwas, was die Flucht nicht zerstören kann. Liebende können sich ihren eigenen Raum und ihre eigene Zeit schaffen. Sie können aus der Geschichte aussteigen. Das ist das Schöne.
Marie wirkt ambivalent, zwischen Hingabe und Berechnung.
Die Paula Beer sagte in der Vorbereitung, dass die Marie im Roman, obwohl die Autorin eine Frau ist, wie eine männliche Projektion ist. Die ist wie eine Jeanne d’Arc der Flüchtlinge. Sie wird physisch gar nicht wirklich beschrieben, man hat gar keine Vorstellung von ihr. Was ich dann bei Anna Seghers sehr schön fand, ist, dass sie ein doppeltes Spiel zu spielen scheint, sie ist eben nicht rein und heilig. Aber im Gegensatz zu Georg kennt sie Schuldgefühle. Sie hat ihren Mann verlassen, und sie möchte nicht aufs Schiff steigen, bevor sie diese Schuld nicht getilgt hat. Sie sagt: „Ich muss meinen Mann finden. Ich bin gegenwärtig, ich liebe, aber ich kann kein neues Leben anfangen, wenn das alte verschuldet ist.“ Mit einem Betrug kann sie nicht leben.
Warum haben Sie sich für Cinemascope als Bildformat entschieden?
Mir war wichtig, dass die Räume eine Choreografie zulassen, wo die Figuren nicht nur über die Dialoge miteinander kommunizieren, sondern wo sie mit ihrer Anwesenheit, ihren Bewegungen, mit dem Abstand, den sie zueinander haben, wesentlich mehr erzählen können, als wenn sie dauernd von sich reden. Cinemascope lässt diesen Bewegungsraum zu, damit konnten wir lange Plansequenzen machen und der Choreografie der Schauspieler folgen. Wenn die Marie zum Beispiel zu Georg ins Zimmer kommt, an ihm vorbeigeht, zum anderen Fenster geht, er dann hinter ihr hergeht ... Das haben wir lange geprobt, bis diese Choreografien standen.
Wie haben Sie Franz Rogowski und Paula Beer gefunden, Ihre Hauptdarsteller?
Für den Georg habe ich einen Schauspieler gesucht, dem man abnimmt, dass er sich durchschlägt, der eine bestimmte Körperlichkeit hat. Beim Schreiben hatte ich ein bisschen an Belmondo in „Außer Atem“ gedacht. Simone Bär, mit der ich immer das Casting mache, und auch Bettina Böhler hatten mir gleich Franz Rogowski vorgeschlagen, den ich aus ‚Love Steaks‘ kannte. Das erste, was Franz sagte, als wir uns dann getroffen haben, war, dass ihm der Flipper-Automat nicht gefallen würde, der in der Szene im Pariser Café auftauchte. Flipper-Automaten würde es nicht mehr geben, das käme ihm vor wie eine Reminszenz an die 60er Jahre, aber es ginge in dem Film ja darum, dass das Heute und das Gestern ein Raum wird. Er hatte völlig Recht, den Flipperautomaten habe ich sofort wieder rausgenommen.
Auf Paula Beer hat mich François Ozon aufmerksam gemacht. Ich kannte sie nur als junges Mädchen bei ‚Poll‘, aber ich wusste nicht, wie die weitere Entwicklung bei ihr war. François hatte mir erlaubt, Muster von ‚Frantz‘ zu sehen, bevor der Film rausgekommen ist, und ich war total beeindruckt. Die Paula ist 22, ich weiß nicht, wo sie diese Erwachsenheit hernimmt. Sie hat eine Lebenserfahrung und gleichzeitig eine jugendliche Anmutung, wie ich das vorher noch nicht gesehen habe.
Spielte die Aktualität des Flüchtlingsthemas eine Rolle für die Arbeit an ‚Transit‘?
Ich finde, man muss da immer aufpassen. Als wir ‚Transit‘ vorbereitet haben, wurde z.B. das Lager in Calais geräumt, der sogenannte Dschungel. Und manche Leute sagten: Das müsst ihr aufnehmen, ihr müsst die afrikanischen Flüchtlinge zeigen, die Fluchtboote, die angespülten Leichen in Lampedusa. Aber das geht nicht. Ich kann das nicht, afrikanische Flüchtlinge filmen, ich habe kein Recht dazu. Ich weiß nicht, was das ist. Was wir im Film haben, ist der Maghreb in Marseille, aber das gehört zur Stadt, zur französischen Kolonialgeschichte, die ist ja da. Unsere Aufgabe ist gewesen, den Raum der Erzählung um das zu bilden, was da ist.
Der Krieg und die Gründe der Vertreibung kommen in ‚Transit‘ nur als Gegebenheit vor, sie werden nicht dramatisiert.
Ich glaube, das steckt tief drinnen, dass man auf der Flucht vergisst. Man hasst das, was einen hat fliehen lassen, und man hat keine Sprache mehr, in der man Zuhause ist und die einem die Welt eröffnet. Der Franz Rogowski hat das sehr gut begriffen. Wenn der Georg bei dem amerikanischen Konsul ist, sagt er: „Ich schreibe keine Aufsätze mehr“. Das ist der Originaltext von Anna Seghers. Und er sagt das so, als ob er in diesem Moment plötzlich alles begreift und empfindet, was er erlebt hat. Und wenn er am Ende sagt: „Der Krieg“, dann läuft es mir immer ganz kalt den Rücken herunter.
Wir hatten beim Drehen manchmal Schwierigkeiten, weil nach den Terroranschlägen in Nizza und Paris immer noch der Ausnahmezustand in Frankreich gilt. Wenn wir dann mit unseren Polizei-Einsatzkommandos durch die Straßen gelaufen sind, haben die Leute erst einmal Angst bekommen. Was mir beim Drehen so auffiel, in der Konstruktion von Gegenwart und dem Vergangenen, ist, dass dieser Moment, selber zum Flüchtling zu werden, so vorstellbar ist. Eigentlich, ganz tief drinnen, ist der Flüchtling unsere Identität.